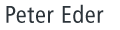







































Die Bildserie entstand 2005 aus Anlass des 30jährigen Bestehens der Raumplanung. Ich schrieb damals folgenden Text dazu, den ich nach wie vor für gültig halte:
"Durch das studium der alten dinge versteht man die neuen" - so steht es auf der Tafel im Bild von Arnfels, und so wollten wir auch versuchen, anhand von vergleichenden Bildern die Veränderungen von etwa 100 Jahren im Orts- und Landschaftsbild aufzuspüren. Es sei vorweggenommen, dass diese Veränderungen nicht immer so schwerwiegend waren, wie es die Erwartungshaltung vermuten ließ, dass sich aber doch bestimmte Muster herauslesen lassen. Vielleicht sind die Veränderungen aber auch deshalb nicht so schwerwiegend, weil die Postkartenfotografie per definitionem sich damals schon auf die Schokoladenseiten konzentrierte.
Bei der Konzeption vermuteten wir schon, dass ein Hauptproblem des Projektes die Unzugänglichkeit des Originalstandortes durch Verbauung werden würde. Erstaunlicherweise war dies kaum der Fall, viel öfter hinderten Umzäunungen und Bewuchs die Aufnahme. Vor allem in den peripheren Einfamilienhausansammlungen, die naturgemäß die besten Aussichtslagen besetzen, wird dem ungehemmten Bedürfnis nach Privatheit nichts entgegengesetzt. Historische Durchwegungen verschwinden, unüberwindliche Thujenhecken verhindern jegliche Aussicht.
Der Wunsch nach Überblick ist ein archaischer, er bedeutet Orientierung und Sicherheit. Im 19. Jahrhundert, als die Natur als Konsumgut entdeckt wurde, baute man auf allen möglichen, per Tagesausflug erreichbaren Anhöhen Aussichtstürme, von denen aus sehr oft die Ansichtskarten aufgenommen wurden. Viele dieser Warten sind wieder verfallen oder zugewachsen, wie z.B. die Kernstockwarte am Plabutsch. Eine große Anzahl von Fotostandorten konnte so wegen der dichten Bewaldung nicht nachvollzogen werden, leider vor allem in der Nähe von größeren Orten, wo die Veränderung des Siedlungsraumes besonders deutlich zu zeigen gewesen wäre.
War aus unserer städtischen Sicht die Zersiedelung als das Hauptübel erwartet worden, zeigte sich ganz deutlich, dass es außerhalb der an den Verkehrsachsen liegenden Ballungsräume Orte gibt, deren Weichbilder sich kaum verändert haben und dass in höheren Lagen die bewirtschafteten Flächen dramatisch abgenommen haben - man hat dort manchmal den Eindruck, die Steiermark würde zuwachsen [➝Kulm, Vordernberg]. Ich möchte von einer tief greifenden Veränderung der Kulturlandschaft sprechen. Da diese im allgemeinen als "Natur" begriffen wird, sollte im Sinne ihres Wertes als Lebensgrundlage in einer immer mehr freizeitorientierten Gesellschaft etwa das Forstgesetz „durchforstet“ oder Finanzierungen für Landschaftspflege angedacht werden.
Während also die Erweiterungen um die Ortskerne durchaus geordnet vor sich gegangen zu sein scheinen, sind es die vorwiegend auf Hängen gelegenen Einzellagen, an denen die Scheußlichkeiten festzumachen sind. Hier greifen die in den Anfängen der Ortsplanung verordneten, überregulierenden, einer verniedlichenden Vorstellung von ländlichem Bauen verhafteten Bebauungsrichtlinien überhaupt nicht, die sich vor allem an Dachformen und Oberflächen orientierten. Um ein Gebäude landschaftsgerecht zu planen, bedarf es meiner Ansicht nur dreier Voraussetzungen:
Erstens einer ausgewogenen Proportion: Ein Gebäude bedarf eines harmonischen Verhältnisses von Länge zu Breite zu Höhe. Mit maximaler Geschoßanzahl und vorgeschriebener Dachneigung lässt sich kein ausufernder Grundriss beherrschen, es entsteht nur ein Fladen mit weithin sichtbarer Dachfläche. Große Gebäude sind in Einzelbaukörper aufzulösen, deren geschickte Stellung zueinander ein Ensemble ergibt. Die Art der Dachform ist dabei überhaupt nicht Ausschlag gebend und sollte kein Glaubensthema sein. Die zweite Voraussetzung ist die Einbindung in die Landschaft. Das Haus ist dem Gelände anzupassen und nicht umgekehrt. Man kann nicht Hanglagen mit den unvermeidlichen, niemals zuwachsenden, aber günstig zu errichtenden Steinschlichtungen zu einem ebenen Grundstück umwandeln. Diese Eingriffe sind gravierend für das Landschaftsbild (und den Unterlieger) und ließen sich mit Willen zum Vollzug der Bauordnung leicht vermeiden. Dass das Haus selbst auch mit unterschiedlichen Niveaus auf den Hang zu reagieren hat, ist selbstverständlich. Und drittens bedarf es einer überlegten, dezenten Farbgebung. Leider hat die Industrie inzwischen Farben entwickelt, die zwar länger halten mögen, aber in Ihrer Buntheit und Leuchtkraft unerträglich sind. Ganz zu schweigen von den glasierten Dachziegeln, die in Mode gekommen sind.
In städtischen Situationen ist die Veränderung des Straßenraumes durch das Auto evident und unvermeidlich. Er war ursprünglich als durchgehender Raum zwischen den Häuserzeilen erfahrbar, was auch den Grazer Gründerzeitvierteln eine gewisse Großzügigkeit verlieh. Durch die undurchdringlichen Autoschlangen beiderseits der Gehsteige verengt sich der Raum zu drei Schluchten, der Fahrbahn und den (in Graz immer zu schmalen) Gehsteigen. In den Ortszentren selbst war aber sehr oft die ursprüngliche Situation wieder zu finden, beeinträchtigt vielleicht nur durch einen unsensiblen Ausbau oder den unvermeidlichen Baum [➝Arnfels, Fürstenfeld]. Interessant die Bilder aus Graz: Straßenbahnschienen in der St. Peter Hauptstraße und am Glacis! St. Peter definierte sich übrigens durch den Kirchturm als Vorort, was mit einer auf solche Spitzfindigkeiten nicht Acht nehmenden Bebauung zunichte gemacht wurde. Plätze waren Aktionsflächen für alle Arten des Handels, Verkehrs und des Zusammenlebens und deshalb frei von Einbauten. Hier zeigt sich heute ein Phänomen: die Angst vor der Fläche, gepaart mit ungezügelter Gestaltungswut. Viel Geld wurde in die Umgestaltung der Plätze investiert, sehr gute Beispiele gibt es zuhauf. Doch noch mehr Energie wird verwendet, diese Räume mit Grünzeug, Stadtmöbeln und tausend verschiedenen Masten und Schildern wieder zu verstellen [➝Leibnitz, Gamlitz, Kindberg].